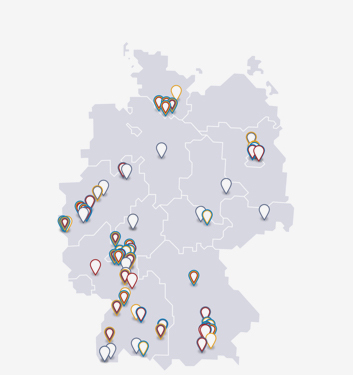vfa-Faktencheck zum Gutachten des Sachverständigenrates Gesundheit & Pflege 2025
Der Sachverständigenrat Gesundheit & Pflege hat am 22. Mai 2025 ein Gutachten mit dem Titel „Preise innovativer Arzneimittel in einem lernenden Gesundheitssystem“ veröffentlicht. Festzuhalten ist, dass die Ausführungen im Gutachten weder dem bestehenden System der Preisbildung und Innovationsförderung noch der Schlüsselrolle der pharmazeutischen Industrie für den Forschungs- und Industriestandort Deutschland gerecht werden. Auch die Auswahl der herangezogenen Expert:innen ist äußerst unausgewogen und lässt eine wirtschaftliche Perspektive sowie die Balance der Argumente für politische Ableitungen vermissen. Die einseitigen Empfehlungen können daher nicht als Leitfaden für sinnvolle Reformen dienen. Der vfa hat sich mit wesentlichen Aussagen und Empfehlungen auseinandergesetzt und unterzieht diese im Folgenden einem Faktencheck.

Hintergrund:
Einleitend heißt es im Gutachten, dass das deutsche Gesundheitssystem im internationalen Vergleich eine hohe und schnelle Verfügbarkeit neuer Arzneimittel biete. Die Arzneimittelausgaben seien jedoch in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Für innovative Arzneimittel seien immer höhere Preise zu beobachten. Der durchschnittliche Preis eines neu eingeführten patentgeschützten Arzneimittels habe vor 15 Jahren bei rund 1000 Euro gelegen und schwankte zuletzt um einen Wert von 50 000 Euro.
vfa-Check
Das deutsche Gesundheitssystem bietet einen guten Zugang zu neuen Arzneimitteln. Der internationale Vergleich fällt aber ernüchternd aus: im Vergleich zu den USA besteht in Europa ein deutlicher Innovationsrückstand. Dieser Rückstand ist insbesondere auf längere Zulassungsprozesse zurückzuführen und zeigt sich in der verzögerten Verfügbarkeit neuer Arzneimittel.
Mehr unter Innovationsrückstand
Der Anteil der pharmazeutischen Industrie an den GKV-Leistungsausgaben ist seit Jahren konstant. Dies wird selbst im Gutachten so festgestellt. Der Anteil der patentgeschützten Arzneimittel bewegt sich ebenfalls seit Jahren unter der 50-Prozent-Marke. Zudem wirken im Arzneimittelmarkt bereits zahlreiche Kostendämpfungsinstrumente. Allein durch das AMNOG-Verfahren werden 12,2 Milliarden Euro Entlastung für die gesetzlichen Krankenkassen für das Jahr 2025 erwartet.
Mehr unter Arzneimittelmarkt in Deutschland: Analyse der Arzneimittelausgaben.
Ein simpler Vergleich der durchschnittlichen Preise ungeachtet der Verordnungshäufigkeit ist nicht sachgerecht. Der medizinische Fortschritt ermöglicht immer mehr zielgerichtete Therapien. Die Häufigkeit der Erkrankungen bzw. die Anzahl der Betroffenen, die mit neuen Arzneimitteln behandelt werden können, ist heute um 97 Prozent geringer als noch vor 15 Jahren. Die neuen Arzneimittel müssen zudem deutlich seltener eingenommen werden, weil sich die Behandlungsintervalle in den letzten 20 Jahren deutlich verändert haben. In einigen Fällen, beispielsweise bei Gentherapien, handelt es sich um hochinnovative Einmalanwendungen.
Mehr unter Spotlight Pharma Market: Besondere Therapiesituationen und
Entwicklung der Behandlungsfrequenzen in den letzten 20 Jahren
Empfehlung 1:
Der Rat empfiehlt zunächst eine verbindliche Festlegung der zweckmäßigen Vergleichstherapie im AMNOG-Verfahren einige Monate vor Einreichung des Dossiers, damit es aufgrund einer kurzfristigen Änderung nicht zu einem nicht belegten Zusatznutzen kommt.
vfa-Check
Verlässliche Rahmenbedingungen sind essenziell für den Pharmastandort Deutschland, für die Entwicklung innovativer Arzneimittel und damit für die Versorgung. Im AMNOG-Verfahren ist die Verlässlichkeit aufgrund von kurzfristigen Änderungen der zweckmäßigen Vergleichstherapie in der Tat häufig nicht gegeben. Die Vorgaben zur zweckmäßigen Vergleichstherapie sollten mehr Planungssicherheit für die Durchführung klinischer Studien, die Nutzenbewertung und die Erstattung gewährleisten. Eine zweckmäßige Vergleichstherapie sollte daher in der Nutzenbewertung ergänzend herangezogen werden, wenn sie übereinstimmend zur G-BA-Beratung in einer klinischen Studie eingesetzt wurde.
Mehr unter Zweckmäßige Vergleichstherapie - mehr Verlässlichkeit erforderlich
Empfehlung 2:
Der Rat empfiehlt weiter, die bestehende Orphan-Drug-Regelung abzuschaffen, da diese die AMNOG-Logik untergrabe. Statt einer Sonderrolle in der frühen Nutzenbewertung solle der Orphan-Drug-Status im Rahmen der Preisverhandlungen als zusätzliches Kriterium berücksichtigt werden.
vfa-Check
Im AMNOG-Verfahren wurde von Beginn an die Notwendigkeit mitgedacht, die besondere Situation bei Orphan Drugs zu berücksichtigen. Die AMNOG-Regelung ist eine logische Umsetzung der EU-Verordnung 141/2000 und stellt einen reibungslosen, möglichst schnellen Zugang der Orphan Drugs hierzulande sicher, damit sie als wichtige Therapieoptionen für Menschen mit seltenen Erkrankungen zur Verfügung stehen.
Nach Markteintritt zeigt sich, dass es zu deutlichen Preissenkungen bei Orphan Drugs und damit zu direkten Einsparungen für die GKV kommt. Die Regelung funktioniert also genau so, wie sie es tun sollte. Dabei unterliegen gut 80 Prozent der Orphan Drug-Umsätze bereits einer uneingeschränkten AMNOG-Bewertung. Denn: ab einem Jahresumsatz von 30 Millionen Euro wird ein Orphan Drug im AMNOG erneut und wie jedes andere innovative Medikament bewertet. Der überwiegende Teil der Orphan Drugs (rund 75 Prozent) generiert hingegen Jahresumsätze unter 30 Millionen Euro.
Eine erst kürzlich veröffentlichte Studie hat die immense Bedeutung der Orphan Drug-Regelung für die Marktverfügbarkeit aufgezeigt: bei ihrer Abschaffung wären 57 Prozent der Orphan Drugs einem sehr hohen bis maximalen Marktrücknahmerisiko ausgesetzt.
Mehr unter: Fakten zu Orphan Drugs,
Abschaffung der Orphan Drug-Regelung: Nur zu Lasten der Patientenversorgung und Spotlight Pharma Market Orphan Drugs
Empfehlung 3:
Der Rat empfiehlt außerdem, einen extern festgelegten Interimspreis einzuführen, der sich an den Kosten der zweckmäßigen Vergleichstherapie orientiert und an die Stelle des durch den pharmazeutischen Unternehmer gewählten Initialpreises tritt. Die Differenz zwischen dem zunächst festgelegten Interimspreis und dem später verhandelten Erstattungsbetrag würde rückwirkend ab der Markteinführung ausgeglichen. Auf diese Weise solle eine „psychologische Ankerwirkung” des Initialpreises in der Preisverhandlung vermieden werden.
vfa-Check
Richtig ist, dass es im AMNOG nicht um simple Rabatte auf den Initialpreis, sondern um die Vereinbarung eines angemessenen Preisaufschlages auf den aktuellen Therapiestandard oder, wenn kein Zusatznutzen festgestellt wurde, um die Einhaltung strikter Preisobergrenzen geht. Der Initialpreis ist auch kein Kriterium für die Preisverhandlungen. Zu den unterstellten psychologischen Effekten eines Initialpreises liefert das Gutachten keine Evidenz.
Pauschale Interimspreise auf dem Niveau der zweckmäßigen Vergleichstherapie würden hingegen als 4. Hürde wirken und in eklatanter Weise den frühen Marktzugang in Deutschland gefährden. Dies, obwohl schon heute nahezu alle Verfahren (96 Prozent) mit einem verhandelten Erstattungsbetrag und damit zu einem Interessenausgleich zwischen dem GKV-Spitzenverband und pharmazeutischen Unternehmen abgeschlossen werden. Die freie Preissetzung wurde bereits im Zuge des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes durch die rückwirkende Geltung des Erstattungsbetrages ab Monat 7 stark eingeschränkt.
Empfehlung 4:
Im Gutachten wird behauptet, dass bei den Preisverhandlungen eine Asymmetrie der Verhandlungsmacht zum Nachteil des GKV-Spitzenverbandes bestünde. Der GKV-Spitzenverband könne sich im Gegensatz zum pharmazeutischen Unternehmer nicht von einer Preisverhandlung zurückziehen und müsse auch eine Preisfestsetzung durch die Schiedsstelle akzeptieren. Der Rat empfiehlt, dem GKV-Spitzenverband zu ermöglichen, von den Preisverhandlungen zurückzutreten und damit über die Erstattungsfähigkeit zu entscheiden. Zudem wird empfohlen, wirkstoffübergreifende Ausschreibungen und somit einen Wettbewerb um die Erstattungsfähigkeit zu ermöglichen.
vfa-Check
Fakt ist, dass für die Hersteller regelhaft eine Wettbewerbssituation durch die Behandlungsalternativen besteht. Das Gutachten widerspricht sich selbst, wenn es im gleichen Kapitel zunächst von einem Monopol und später von einem Wettbewerb der Hersteller spricht. Die Asymmetrie der Verhandlungsmacht besteht vielmehr zum Nachteil des pharmazeutischen Unternehmens. Der GKV-Spitzenverband ist als alleiniger Nachfrager (Monopsonist) in allen Preisverhandlungen involviert und hat somit einen Informationsvorteil gegenüber den pharmazeutischen Unternehmen. Er ist zudem an der Festlegung der Bewertungsmaßstäbe, der Beratung zu den Studien, der Festlegung der zweckmäßigen Vergleichstherapie sowie Beschlüssen über den Zusatznutzen im G-BA beteiligt. Somit agiert er als Regelgeber, Spieler und Schiedsrichter zugleich, was zur bekannten Governance-Problematik im AMNOG-Verfahren führt.
Mehr unter www.monitor-versorgungsforschung.de
Fakt ist zudem, dass alle Erstattungsbeträge nach engen gesetzlichen Vorgaben mit dem GKV-Spitzenverband gemäß ihrem Zusatznutzen verhandelt werden. Die eingeführten “Leitplanken” des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes haben das Verhandlungskorsett noch enger geschnürt und teilweise strikte Preisobergrenzen eingeführt. Der GKV-Spitzenverband kann als Verhandlungspartner ebenso den weiteren Verlauf der Verhandlungen maßgeblich beeinflussen und über seine Forderungen entscheiden. Die Schiedsstelle sorgt in seltenen Fällen für eine Entscheidung, welche die Forderungen des GKV-Spitzenverbandes berücksichtigt.
Der Vorschlag des Rates, die Erstattungsfähigkeit je Einzelfall direkt in die Hände der zentralen Interessensvertretung der Kostenträger zu legen, gleicht einer 4. Hürde und unterwandert das Prinzip der gemeinsamen Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. Der weitere Vorschlag, die Erstattungsfähigkeit für Therapiealternativen im Rahmen eines Bieterwettbewerbs einzuschränken, gefährdet die Versorgungssicherheit.
Empfehlung 5:
Arzneimittel ohne belegten Zusatznutzen erzielen laut Gutachten hohe Preise, was gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot verstoße. Der Rat empfiehlt daher, die Preise innovativer Arzneimittel noch konsequenter an deren Zusatznutzen zu koppeln und zu diesem Zweck eine regelmäßige Reevaluation zu ermöglichen.
vfa-Check
Die AMNOG-Regularien geben klar vor, dass die Kosten neuer Arzneimittel mit einem nicht belegten Zusatznutzen die Kosten der zweckmäßigen Vergleichstherapie nicht übersteigen sollen. Die Praxis belegt dies für 100% aller eindeutig quantifizierbaren Fälle. Ein Verstoß gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot ist folglich ausgeschlossen. Auch für Teilpopulationen ohne belegten Zusatznutzen gilt beim Mischpreis diese Vorgabe. Zugleich können auch Arzneimittel ohne belegten Zusatznutzen einen wichtigen Stellenwert in der Versorgung einnehmen und sind aus mehreren Gründen von enormer Bedeutung für Patientinnen und Patienten.
Mehr unter „Die Spreu vom Weizen trennen“ - wie nützlich ist ein nicht belegter Zusatznutzen?
Es ist ebenso von Anfang an das Kernprinzip des AMNOG gewesen, dass der Preis neuer Arzneimittel an den Zusatznutzen gekoppelt sein soll. Dieses Prinzip wurde durch die “Leitplanken” in Teilen gebrochen: Denn ein Mehr an Nutzen darf in bestimmten Konstellationen nicht mehr kosten. Ebenso ist eine Reevaluation nicht nur möglich, sondern unter anderem durch Befristungen des G-BA längst die Regel. Die Mehrzahl der AMNOG-Verfahren findet als eine erneute Bewertung oder eine Bewertung im neuen Anwendungsgebiet statt.
Mehr unter AMNOG - Jahresrückblick 2024
Empfehlung 6:
Der Rat fordert die Einführung eines jährlich anzupassenden Arzneimittelbudgets für patentgeschützte Arzneimittel. Bei Überschreitung der Budgetgrenze würden einheitliche, prospektiv festgelegte prozentuale Preisabschläge auf alle eingeschlossenen Arzneimittel anfallen.
vfa-Check
Im AMNOG-Verfahren bestehen bereits produktspezifische Regulierungsinstrumente wie die Vorgabe zur verpflichtenden Vereinbarung von mengenbezogenen Aspekten in der Preisverhandlung. Zusätzliche Arzneimittelbudgets mit möglichen weiteren Preisabschlägen wären hingegen ein massiver Eingriff in das etablierte Verfahren der nutzenbasierten Preisbildung. Sie würden Innovationsanreize drastisch einschränken und den pharmazeutischen Unternehmen wichtige Planungssicherheit nehmen. Das AMNOG-Verfahren würde als Preisregulierungsinstrument komplett entwertet. Der Vorschlag ist insgesamt weder notwendig noch zielführend und dürften zu einer verdeckten Rationierung für die Patientinnen und Patienten führen.
Empfehlung 7:
Die verhandelten Preise für innovative Arzneimittel seien statisch und würden nach Markteintritt in der Regel nicht angepasst. Der Rat empfiehlt daher die Einführung einer dynamischen Preisanpassungssystematik und Preisanpassungen im Zeitverlauf vor Ablauf des Patentschutzes. Auf diese Weise solle auch einer behaupteten selbstverstärkenden Preisspirale („Turmtreppeneffekt“) im AMNOG-System entgegengewirkt werden. Zudem wird eine Monitoringstrategie zur systematischen Sichtung von neuer Studienevidenz zum Zwecke der Reevaluation und dem Auslösen neuer Preisverhandlungen empfohlen.
vfa-Check
Die verhandelten Preise sind nicht statisch. Neuverhandlungen erfolgen aufgrund regelhaft befristeter Vereinbarungen, Befristungen von G-BA-Beschlüssen oder Nutzenbewertungen für neue Anwendungsgebiete permanent.
Statt eines “Turmtreppeneffekts” führen die zwingenden Vorgaben für die Preisverhandlung bereits heute dazu, dass sich das Preisniveau über einen „Kellertreppeneffekt“ weiter über die Zeit reduziert. Falsch ist auch, dass es einer neuen Monitoringstrategie bedarf. Die neue Evidenz durch geplante Studien oder neue Datenschnitte wird vom G-BA stets überprüft, was regelhaft zu Befristungen zwecks einer Neubewertung führt. Auch zwischenzeitliche Reduktionen des Erstattungsbetrages der zweckmäßigen Vergleichstherapie können in nachfolgenden Verhandlungen bereits heute berücksichtigt werden und bedürfen keines Automatismus.
Empfehlung 8:
Der Rat empfiehlt für Einmalgaben, stärker auf den Einsatz von erfolgsabhängigen Vergütungsmodellen (sogenannten Pay-for-Performance-Modellen) zu setzen sowie Anpassungen in der Systematik des Risikostrukturausgleichs durchzuführen.
vfa-Check
In besonderen Therapiesituationen kann zum Zulassungszeitpunkt eines Arzneimittels eine begründbar limitierte Evidenz vorliegen. Erfolgsabhängige Erstattungsmodelle, so auch „Pay-for-Performance“-Ansätze, können eine Stellschraube sein, Patientinnen und Patienten auch in Zukunft einen schnellen Zugang zu wichtigen Therapien zu ermöglichen. Die praktische Ausgestaltung im AMNOG steht jedoch vor Herausforderungen. Für die Umsetzung ist eine Weiterentwicklung des gesetzlichen Rahmens erforderlich, um gemeinsam einzelfallgerechte und flexible Lösungen zu entwickeln. Die geforderten Anpassungen des Risikopools im Morbi-RSA sind notwendig, um verschiedene Vertragsmodelle zu ermöglichen.
Mehr unter Zukunft AMNOG: Neue Impulse für die Patientenversorgung
Empfehlung 9:
Das Gutachten empfiehlt die Rücknahme, der im Medizinforschungsgesetz (MFG) verankerten Ausnahmeregelungen der Leitplanken. Zugleich wird festgestellt, dass die pharmazeutische Industrie einen bedeutenden Beitrag zur deutschen Wirtschaftsleistung leiste. Durch verbesserte Rahmenbedingungen am Standort Deutschland solle diese zukunftsträchtige Branche im Sinne wirtschafts- und gesundheitspolitischer Ziele weiterentwickelt und gefördert werden.
vfa-Check
Die MFG-Regelung hat grundsätzlich die richtige Zielsetzung einer besseren Forschungsförderung verfolgt. Die ersten Erfahrungen zur Ausnahme-Option für die „Leitplanken“ zeigen jedoch, dass die technische Ausgestaltung zu mehr Bürokratie und weniger Planungssicherheit führt. Allein eine komplette Abschaffung der Leitplanken könnte hier Abhilfe schaffen.
Es ist wichtig, dass die Pharma-Branche als Schlüsselindustrie für Deutschland anerkannt wird. Folgerichtig ist daher die Empfehlung, die zukunftsorientierte und hochinnovative Brache zu stärken. Dieser Ansatz ist jedoch nicht mit den meisten oben genannten Aussagen und Forderungen des Rates vereinbar.
Mehr zur gesundheitspolitischen Debatte um Preise innovativer Arzneimittel:
Innovative Arzneimittel im Fokus – was zur Preisdebatte dazu gehört
Mehr zur Bedeutung der Pharma-Branche:
#StarkAmStandort